Psalm 6
GOTT, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, GOTT, denn ich verschmachte, heile mich, GOTT, denn meine Gebeine sind erschrocken. Tief erschrocken ist meine Seele. Du aber, GOTT, wie lange? Kehre wieder, GOTT, errette mein Leben, hilf mir um deiner Gnade willen. Denn im Tod gedenkt man deiner nicht, wer wird im Totenreich dich preisen? Ich bin erschöpft von meinem Seufzen, ich tränke jede Nacht mein Bett, mit meinen Tränen überschwemme ich mein Lager. Schwach geworden ist mein Auge vor Gram, matt geworden von allen, die mich bedrängen. Weicht von mir, ihr Übeltäter alle, denn GOTT hat mein lautes Weinen gehört. GOTT hat mein Flehen gehört, GOTT nimmt mein Gebet an. Es werden zuschanden, es erschrecken alle meine Feinde, sie werden zurückweichen, werden zuschanden im Nu.
Der Sprecher dieses Psalms klagt über eine ganze Reihe von Leiden: Er ist anscheinend krank, und zwar körperlich und seelisch: „Ich verschmachte ... meine Gebeine sind erschrocken ... tief erschrocken ist meine Seele.“ Deshalb bittet er Gott: „Heile mich! ... Kehre wieder! ... Errette mein Leben! ... Hilf mir um deiner Gnade willen!“ Er sieht sich schon an der Schwelle des Todes. Deshalb ist es seiner Meinung nach so dringlich, dass Gott ihm hilft und ihn vor dem Tod rettet. Denn wenn er tot ist, kann er Gott nicht mehr loben und preisen. Als Toter kann er nicht einmal mehr an Gott denken. Hätte Gott nicht mehr davon, wenn er den Bittsteller rettet und dafür gelobt wird? (Ein Gedanke, der für uns vielleicht etwas befremdlich ist.) Aber auch jetzt schon, in seiner Krankheit, kann der Sprecher Gott nicht preisen. Dafür ist er viel zu schwach: „Ich bin erschöpft von meinem Seufzen. Ich tränke jede Nacht mein Bett, mit meinen Tränen überschwemme ich mein Lager. Mein Auge ist schwach geworden vor Kummer.“
Neben der Krankheit leidet der Sprecher des Psalms offenbar auch unter Menschen, die ihm feindselig gesonnen sind und ihn bedrängen. Am Ende des Psalms hat man fast den Eindruck, dass der Sprecher seine Krankheit ganz vergessen hat, denn er spricht nur noch von seinen Feinden, die er als Übeltäter tituliert: „Ich bin matt geworden von allen, die mich bedrängen. Weicht von mir, ihr Übeltäter alle, denn GOTT hat mein lautes Weinen gehört. GOTT hat mein Flehen gehört, GOTT nimmt mein Gebet an. Es werden zuschanden, es erschrecken alle meine Feinde, sie werden zurückweichen, werden zuschanden im Nu.“
Krankheit und Feinde sind Probleme, die auch sonst in den Klagepsalmen oft angesprochen werden. Beides hat die Menschen damals anscheinend weit mehr bedrängt als es bei uns heute der Fall ist. Wir können heute Schmerzen mit Medikamenten lindern und viele Krankheiten problemlos heilen denen die Menschen damals hilflos ausgeliefert waren. Eine Grippe, eine Lebensmittelvergiftung, eine Blinddarmentzündung, eine verschmutzte Wunde, ein Arm- oder Beinbruch, so etwas konnte einen Menschen damals umbringen oder zum Invaliden machen.
In den Dörfern, und kleinen Städten, in denen fast alle Menschen von Ackerbau und Viehzucht lebten, konnte es schnell zu Streitigkeiten zwischen Nachbarn kommen: Dein Vieh hat von meiner Weide gefressen. Deine Kuh, auf die Du nicht aufgepasst hat, hat meinen Garten zertrampelt oder sogar mein Kind getötet. Du machst meiner Frau schöne Augen. Dein Sohn hat meine Tochter verführt. Du hast bei unseren Nachbarn Lügen über mich verbreitet. Konflikte zwischen Nachbarn konnten leicht eskalieren. Es gab keine Polizei, die man zur Hilfe rufen konnte.
Vielleicht nennt unser Psalm Krankheit und Feinde nebeneinander, damit sich möglichst viele Leser oder Hörer in diesem Gebet wiederfinden konnten. Vielleicht ist der Gedanke aber auch, dass Krankheit - körperlich oder seelisch - oft Aggressionen bei den Mitmenschen eines Kranken auslöst. Sie müssen die Arbeiten übernehmen, die der oder die Kranke sonst erledigen würde. Sie müssen ihn oder sie pflegen und versorgen. Und sie müssen sich die ständigen Klagen und das dauernde Gejammer anhören. Da kann es schon passieren, dass das anfängliche Mitleid mit der Zeit in Ärger oder sogar in offene Feindseligkeit umschlägt.
Neben Krankheit und Feinden scheint den Sprecher unseres Psalms aber noch etwas weiteres zu bedrücken: Er betrachtet sein ganzes Unglück als eine Strafe und Zurechtweisung durch Gott. Deshalb bittet er Gott: „Strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig ...“ Dabei bezeichnen die Ausdrücke für „strafen“ und „züchtigen“ im Hebräischen weniger eine Strafe im juristischen Sinne, sondern eher Erziehungsmassnahmen, zu denen damals selbstverständlich auch noch das „züchtigen“ gehörte.
In vielen Psalmen beklagt sich der Sprecher darüber, dass ihm Unrecht widerfahren ist, obwohl er unschuldig ist und keine gravierenden Fehler gemacht hat in seinem Leben. Das setzt voraus, dass Unglück normalerweise die Strafe dafür ist, dass jemand etwas unrechtes getan hat. Wer nichts unrechtes getan hat, den oder die sollte eigentlich auch kein Unglück treffen.
Der Sprecher unseres Psalms protestiert nicht dagegen, dass Gott ihn mit Unglück bestraft und züchtigt. Er bittet Gott nur, ihn nicht in seinem Zorn zu strafen und in seinem Grimm zu züchtigen, ihn also nicht hart zu bestrafen, sondern gnädig und gütig. Entweder hat der Sprecher schon vorher gewusst, dass er etwas falsch gemacht hat, oder sein Unglück hat es ihm bewusst gemacht. Er steht zu seiner Schuld und akzeptiert, dass er dafür bestraft wird. Er bittet nur um eine gnädige Strafe, die ihn nicht umbringt, sondern ihn wieder ins Leben zurück führt.
Wenn ich auf mein Leben zurück schaue, kommen mir durchaus Zeiten und Situationen in den Sinn, in denen ich micht ähnlich gefühlt habe wie der Sprecher dieses Psalms, in denen es mir verdientermassen schlecht ging, in denen Unglück und Leid für mich ein Anstoss waren, darüber nachzudenken, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe und wie ich es besser machen könnte, und in denen mir klar war, dass ich das aus eigener Kraft nicht schaffen würde, sondern nur mit Gottes gnädiger Hilfe. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich.
Der Gedanke, dass Unglück und Leid eine Strafe Gottes sein können, durch die wir herausgefordert werden, uns kritisch zu prüfen, Fehler zu erkennen und zu versuchen, uns zu bessern, der Gedanke, dass Gott uns durch Unglück und Leid erziehen, belehren und den Weg in ein neues Leben zeigen will, dieser Gedanke hat durchaus etwas für sich. Er kann uns helfen, im Unglück nicht zu verzweifeln und zu versinken, sondern daraus zu lernen und gestärkt und verwandelt daraus hervorzugehen.
Der Gedanke, dass Unglück und Leid eine Strafe Gottes sind, kann uns aber auch den Blick für die Wirklichkeit verstellen und uns in unserer Lieblosigkeit und Rücksichtslosigkeit bestärken, vor allem dann, wenn wir diesen Gedanken nicht zur Selbstkritik einsetzen, sondern zur Kritik anderer Menschen. Da bekommt der Nachbar mit 50 einen Herzinfarkt: Selber schuld! Warum hat er auch immer so viel gearbeitet, so fett gegessen und keinen Sport getrieben? Das musste ja so kommen. Und jetzt soll ich - via Krankenkasse - auch noch mit-bezahlen für seine Behandlung? Ist das nicht ungerecht? Müsste man Leuten, die so ungesund leben, nicht höhere Prämien abverlangen? Besonders im Gesundheitsbereich wird heute oft so getan, als könne man, wenn man nur alles richtig macht, sein Leben lang von Krankheiten verschont bleiben. (Und dann sind mit sechzig die Gelenke kaputt vom vielen Joggen: Selber schuld!) Aber auch in anderen Bereichen machen wir es uns oft einfach, indem wir so tun, als seien die Menschen für ihr Unglück selbst verantwortlich, ob arbeitslos oder invalid, ob Flüchtling oder Strafgefangener: Selber schuld! Kürzlich habe ich in einem Magazin gelesen: Wer wirklich will und sich ein bisschen Anstrengt, der kann mit 40 Millionär sein. Sie sind kein Millionär? Selber schuld!
Das kann natürlich nicht stimmen. Und das merken wir nicht erst heute. Das haben die Menschen in der Bibel auch schon gewusst. Denken wir nur an Hiob, den Superreichen und Superfrommen, dem Gott sein Hab und Gut, seine Familie und seine Gesundheit wegnimmt, der im Staub und in der Asche draussen vor der Stadt sitzt und dem seine Freunde vorwerfen, dass er sagt: Ich habe doch nichts verbrochen! Ich habe das nicht verdient! Genauso wenig wie all die armen und elenden Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben (oder heute in den „unentwickelten“ Ländern), die den Reichen die Toiletten putzen, den Kaffee pflücken und die Hemden nähen und dabei selbst kaum über die Runden kommen, deren Kinder an einer simplen Infektion sterben, weil es keine erschwinglichen Medikamente gibt. Die haben das auch nicht verdient. Mag sein, dass die Reichen nicht schuld sind am Elend der Armen. Aber sie werden schuldig, wenn sie es mit einem Achselzucken quittieren und nichts dagegen tun. So redet Hiob - und am Ende gibt Gott ihm Recht und die frommen Freunde müssen einsehen, dass sie Unrecht hatten.
Die Gleichung: „Unglück = Strafe für Unrecht“, die geht nicht auf. Diese Einsicht wird unausweichlich, wenn wir uns an Jesus von Nazaret erinnern, nach dem wir uns Christen nennen. Er wurde angefeindet und verspottet, am Ende haben sie ihn gefoltert und umgebracht. Aber das war nicht so, weil er Unrecht getan hatte und dafür bestraft wurde. Jesus hat gelitten und ist gestorben, weil er recht hatte. Viele Menschen konnten das damals nicht begreifen, und viele können es heute noch nicht. „Steig herunter vom Kreuz!“ haben sie ihm zugerufen. „Dann sehen wir, dass du nicht von Gott bestraft wirst.“ Aber Jesus ist nicht vom Kreuz herunter gestiegen.
Mit Jesus am Kreuz ist ein Bild Gottes gestorben, das schon im Alten Testament, bei Hiob und auch in anderen Schriften, als hoch problematisch erkannt worden war: das Bild Gottes als himmlischer Richter oder Erzieher, der die Menschen mit Unglück und Leid bestraft und züchtigt, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Jesus hat den Menschen andere Bilder von Gott vor Augen gestellt: Gott lässt es regnen und die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, über gute und schlechte Menschen. Gott geht den Menschen nach, wenn sie auf Abwege geraten, so wie ein Hirt seinen Schafen, und bringt sie zurück auf den richtigen Weg. Gott freut sich, wenn ein Mensch, der für die gute Sache verloren schien, sich besinnt und auf den rechten Weg zurückkehrt. Gott zahlt jedem den Mindestlohn, den er zum überleben braucht, ob er nun einen Tag, ein paar Stunden oder nur eine Stunde gearbeitet hat. Gott bringt die Menschen zur Besinnung und Umkehr, indem er ihnen ihre Schuld vergibt, nicht indem er sie dafür bestraft.
Der Gott, von dem Jesus gesprochen hat, ist kein Gott der Willkür, wie es manche Götter des alten Orients und der Antike waren, die manchmal einfach aus Willkür oder schlechter Laune heraus einen Menschen, ein Volk oder die ganze Menschheit ins Unglück stürzten. Gott ist aber auch nicht - wie in grossen Teilen des Alten Testaments - ein Gott der Moral und der Gerechtigkeit, der die Guten mit Wohlstand und Glück belohnt und die Bösen mit Unglück und Krankheit bestraft, und der dafür sorgt, dass es jedem genau so ergeht, wie er es verdient hat - sei es hier auf Erden oder dann im Jenseits. Der Gott, von dem Jesus gesprochen hat, ist kein Gott der Willkür und kein Gott der Moral, sondern ein Gott der Liebe und der Freiheit, ja, man kann sagen: Gott ist der Geist der Liebe und der Freiheit, der die Welt und die Menschen durchdringt und erfüllt.
Er hilft den Menschen, zu erkennen, was gut ist und was böse, und jeweils das zu tun, was richtig und nötig ist - so wie der „barmherzige Samariter“, der sieht: Da liegt ein Mensch verletzt am Weg, und der ihm hilft, ohne lange zu überlegen. Die Liebe, der wir unser Leben verdanken und die uns am Leben erhält, befreit uns von der Angst, dass Gott uns für unsere Sünden und Fehler bestraft. Die Liebe, in der wir uns mit allen Menschen und mit der ganzen Schöpfung verbunden wissen, befreit uns von der Fixierung auf unser eigenes Glück oder Unglück. Sie befreit uns auch dazu, unsere Fehler und unsere Schuld zu erkennen, dazu zu stehen und es künftig besser zu machen - und zwar nicht nur dann, wenn es uns schlecht geht, sondern auch und gerade dann, wenn es uns gut geht.
Können wir als Christen, für die Gott der Geist der Liebe und der Freiheit ist, den alttestamentlichen Psalm nachsprechen und Gott bitten: „Strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm“? Ich weiss keine einfache Antwort auf diese Frage. Auf der einen Seite fällt es mir nach allem, was uns Jesus gezeigt hat, nicht so leicht, mir Gott als jemanden vorzustellen, der Menschen in seinem Zorn straft und züchtigt, indem er ihnen Krankheiten und Feinde schickt. Auf der anderen Seite müssen Liebe und Zorn vielleicht auch nicht unbedingt einander widersprechen. Wenn ich einen Menschen liebe, kann es mich gerade deshalb zornig und wütend machen, wenn ich sehe, wie dieser Mensch in sein Unglück rennt. Und wir erziehen unsere Kinder, weil wir sie lieben - auch wenn wir heutzutage auf Schläge und Strafen weitgehend verzichten. So kann ich mich auch als Christ in die Psalmen des Alten Testaments hineindenken und mich zum Teil in ihnen wiedererkennen. Ich möchte mich aber nicht gerne dazu drängen lassen, mir alles, was in den Psalmen steht, auch als Gebet zu eigen zu machen.
Ich habe einmal versucht, mich von dem biblischen Psalm zu eigenen Gedanken inspirieren zu lassen. Ich lese zuerst den Psalm und dann meine Gedanken dazu - vielleicht regt Sie das an, den Psalm zu Hause noch einmal zu lesen und Ihre eigene Version aufzuschreiben.
Psalm 6
GOTT, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, GOTT, denn ich verschmachte, heile mich, GOTT, denn meine Gebeine sind erschrocken. Tief erschrocken ist meine Seele. Du aber, HERR, wie lange? Kehre wieder, GOTT, errette mein Leben, hilf mir um deiner Gnade willen. Denn im Tod gedenkt man deiner nicht, wer wird im Totenreich dich preisen? Ich bin erschöpft von meinem Seufzen, ich tränke jede Nacht mein Bett, mit meinen Tränen überschwemme ich mein Lager. Schwach geworden ist mein Auge vor Gram, matt geworden von allen, die mich bedrängen. Weicht von mir, ihr Übeltäter alle, denn GOTT hat mein lautes Weinen gehört. GOTT hat mein Flehen gehört, GOTT nimmt mein Gebet an. Es werden zuschanden, es erschrecken alle meine Feinde, sie werden zurückweichen, werden zuschanden im Nu.
Ich möchte in meinem Leben nie aufhören, dazu zu lernen. Ich möchte immer wieder erkennen, was ich falsch mache und was ich besser machen kann, auch wenn das weh tut. Und ich möchte das dann auch in meinem Leben umsetzen können. Ich kann das nicht alleine. Ich bin angewiesen auf Kritik und auf Unterstützung.
Ich möchte lernen, in Krankheit und Leid die Hoffnung nicht aufzugeben, dass es mir wieder besser gehen kann. Ich möchte auch erkennen, wo mich Krankheit, Unglück und Leid darauf hinweisen, dass in meinem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Ich möchte lernen, Krankheit und Unglück zu ertragen, wo es nicht zu vermeiden ist, dabei aber dem Leben zugewandt bleiben und offen dafür, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben, solange ich noch nicht tot bin.
Ich wünsche mir, mit meinen Mitmenschen in Frieden zu leben und mich mit meinen Feinden zu versöhnen. Ich wünsche mir, dass der Ungeist des Neids, der Konkurrenz und der Feinschaft überwunden wird durch den Geist der Liebe und der Freiheit.
25.9.19
21.8.19
Freiheit und ihre Grenzen
Die Grenze meiner Freiheit ist die Freiheit meines Nächsten.
Die Grenze der Freiheit meines Nächsten ist meine Freiheit.
Wo liegt diese Grenze?
Die Grenze der Freiheit meines Nächsten ist meine Freiheit.
Wo liegt diese Grenze?
6.8.19
Religion à la carte
In der
NZZ vom 25. Juli 2019 (S. 33) schreibt Laila Mirzo: "Ein aufgeklärter
Mensch kann sich von
Mohammed
nur distanzieren. Ein Austritt aus dem Islam wäre die einzig logische
Konsequenz." Reinhard Schulze hat in der NZZ vom 3. August 2019 (S. 35)
eine Replik auf ihren Artikel veröffentlicht. Ich möchte hier nur dessen oben
zitierte Schlusssätze kritisch in Frage stellen: Stimmt es, dass man aus dem
Islam austreten muss, sobald man sich von Mohammed distanziert und ihn
kritisiert?
(Ich
verstehe "sich distanzieren von" im Sinne von "nicht in allen
Punkten übereinstimmen mit", nicht im Sinne von "nichts zu tun haben
wollen mit". Vielleicht hat Laila Mirzo es anders gemeint und ist der
Ansicht, dass es bei Mohammed und beim Islam überhaupt nichts Gutes und
Bedenkenswertes gibt. Dann gehen meine folgenden Überlegungen an ihrer
Argumentation vorbei. Aber dann wäre ihre Argumentation auch höchst pauschal
und fragwürdig.)
Ich
denke, man muss eine Religion (oder eine Kultur) nicht als Paket einkaufen und
komplett übernehmen oder komplett ablehnen. Man kann auswählen, was einem
einleuchtet, verwerfen, was einem nicht gut erscheint, bewahren und pflegen,
was ein wenig seltsam ist und womit man nicht viel anfangen kann, was sich aber
früher einmal als sinnvoll bewährt hat und vielleicht in Zukunft wieder einmal
hilfreich sein könnte.
Religionen
verändern sich ja auch im Verlauf der Geschichte. Und zu jeder Zeit
interperetieren und praktizieren verschiedene Anhänger*innen sie auf
unterschiedliche Weise. Der religionsinterne Pluralismus und die
Religionsgeschichte geben den Anhänger*innen einer Religion die Freiheit, ihre
Religion zu verändern oder sie sich auf ihre Weise zurecht zu legen.
Diese Art
der Religionsfreiheit ist nicht erst eine Errungenschaft der Moderne und des
Säkularismus. Es hat sie schon immer gegeben (auch wenn es in den verschiedenen Religionen auch immer wieder Bestrebungen gegeben hat, diese religionsinterne Religionsfreiheit einzuschränken). Sie wird heute oft übersehen -
vielleicht wegen einer weithin mangelhaften Kenntnis der Religionen und ihrer Geschichte.
24.1.19
"Wurzeln"?
Ich habe keine Wurzeln. Ich bin keine Pflanze.
Das Gerede von den "Wurzeln", die Menschen angeblich haben, finde ich ziemlich irreführend.
Ich habe einmal irgendwo gelebt, wo ich schon lange nicht mehr gewesen bin. Jetzt ist es dort wahrscheinlich ganz anders als es damals war.
Das Leben dort hat vielleicht Spuren hinterlassen bei mir, oder auch Wunden und Narben. Ich rede vielleicht immer noch so ähnlich, wie man damals dort geredet hat. In meinem Unbewussten wirkt vielleicht nach, was man mir damals dort beigebracht, eingebläut oder eingeredet hat, wogegen ich vielleicht mein Leben lang angekämpft habe. Sind das Wurzeln? Zehre ich davon?
Wenn Menschen "Wurzeln" haben sollten, dann sollten sie auch das Recht haben, sie aus dem Boden zu reissen und woanders wieder einzupflanzen (oder sie in einen Topf zu pflanzen, den man leicht von einem Ort zum anderen bewegen kann).

Ausser Wurzeln brauchen Pflanzen übrigens auch noch Licht und Luft, Regen und Nährstoffe ...
Wo von "Wurzeln" die Rede ist, sind "Blut und Boden" manchmal nicht weit entfernt:

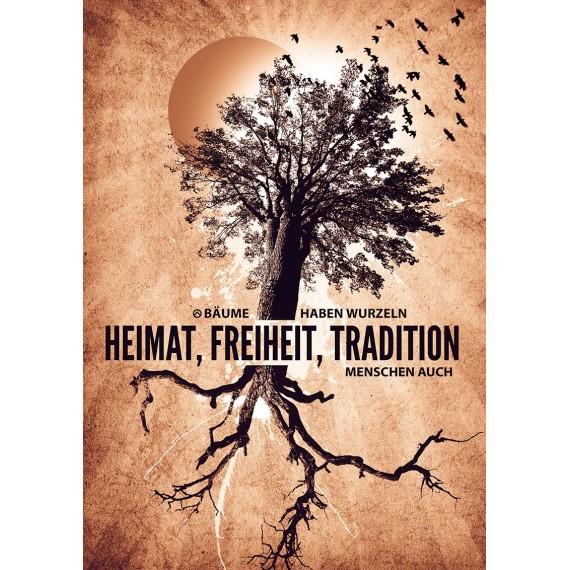
Wenn ich schon Wurzeln haben soll, dann sind sie da, wo ich bin, nicht da, wo ich einmal gewesen bin.
Aber vielleicht sagen sie ja, meine Wurzeln seien woanders, weil sie mich hier nicht haben wollen?
Das Gerede von den "Wurzeln", die Menschen angeblich haben, finde ich ziemlich irreführend.
Ich habe einmal irgendwo gelebt, wo ich schon lange nicht mehr gewesen bin. Jetzt ist es dort wahrscheinlich ganz anders als es damals war.
Das Leben dort hat vielleicht Spuren hinterlassen bei mir, oder auch Wunden und Narben. Ich rede vielleicht immer noch so ähnlich, wie man damals dort geredet hat. In meinem Unbewussten wirkt vielleicht nach, was man mir damals dort beigebracht, eingebläut oder eingeredet hat, wogegen ich vielleicht mein Leben lang angekämpft habe. Sind das Wurzeln? Zehre ich davon?
Wenn Menschen "Wurzeln" haben sollten, dann sollten sie auch das Recht haben, sie aus dem Boden zu reissen und woanders wieder einzupflanzen (oder sie in einen Topf zu pflanzen, den man leicht von einem Ort zum anderen bewegen kann).

Ausser Wurzeln brauchen Pflanzen übrigens auch noch Licht und Luft, Regen und Nährstoffe ...
Wo von "Wurzeln" die Rede ist, sind "Blut und Boden" manchmal nicht weit entfernt:

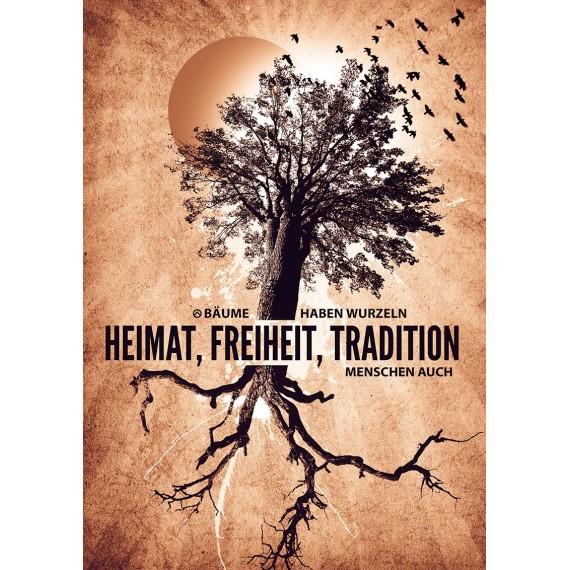
Wenn ich schon Wurzeln haben soll, dann sind sie da, wo ich bin, nicht da, wo ich einmal gewesen bin.
Aber vielleicht sagen sie ja, meine Wurzeln seien woanders, weil sie mich hier nicht haben wollen?
6.1.19
Die Weisen aus dem Morgenland
Matthäus 2,1 Als Jesus in Betlehem in
Judäa zur Zeit des Königs Herodes zur Welt gekommen war, da kamen Sterndeuter
aus dem Morgenland nach Jerusalem 2 und fragten: Wo ist der neugeborene König
der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu
huldigen. 3 Als der König Herodes davon hörte, geriet er in Aufregung und ganz
Jerusalem mit ihm. 4 Und er liess alle Hohen Priester und Schriftgelehrten des
Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren
werden solle. 5 Sie antworteten ihm: In Betlehem in Judäa, denn so steht es
durch den Propheten geschrieben:
6 Und du, Betlehem, Land
Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas; denn aus
dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird.
7 Darauf rief Herodes die
Sterndeuter heimlich zu sich und wollte von ihnen genau erfahren, wann der
Stern erschienen sei. 8 Und er schickte sie nach Betlehem mit den Worten: Geht
und forscht nach dem Kind! Sobald ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit
auch ich hingehen und ihm huldigen kann. 9 Auf das Wort des Königs hin machten
sie sich auf den Weg, und siehe da: Der Stern, den sie hatten aufgehen sehen,
zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. 10 Als
sie den Stern sahen, überkam sie grosse Freude. 11 Und sie gingen ins Haus
hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter; sie fielen vor ihm nieder
und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar:
Gold, Weihrauch und Myrrhe. 12 Weil aber ein Traum sie angewiesen hatte, nicht
zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.
13 Als sie aber fortgezogen
waren, da erscheint dem Josef ein Engel des Herrn im Traum und spricht: Steh
auf, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich
dir Bescheid sage! Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. 14 Da
stand er auf in der Nacht, nahm das Kind und seine Mutter und zog fort nach
Ägypten. 15 Dort blieb er bis zum Tod des Herodes; so sollte in Erfüllung
gehen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen
Sohn gerufen.
16 Als Herodes nun sah, dass
er von den Sterndeutern hintergangen worden war, geriet er in Zorn und liess in
Betlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren
umbringen, entsprechend der Zeit, die er von den Sterndeutern erfragt hatte. 17
Da ging in Erfüllung, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist:
18 Ein Geschrei war zu hören
in Rama, lautes Weinen und Wehklagen, Rahel weinte um ihre Kinder und wollte
sich nicht trösten lassen, denn da sind keine mehr.
19 Als Herodes gestorben war,
da erscheint dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum 20 und spricht:
Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh ins Land Israel. Denn die dem
Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. 21 Da stand er auf, nahm das Kind und
seine Mutter und zog ins Land Israel.
22 Als er aber hörte, dass
Archelaus anstelle seines Vaters Herodes König geworden war über Judäa,
fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Weil aber ein Traum ihn angewiesen hatte,
zog er sich in die Gegend von Galiläa zurück 23 und liess sich in einer Stadt
namens Nazaret nieder; so sollte in Erfüllung gehen, was durch die Propheten
gesagt ist: Er wird Nazarener genannt werden.
***
Wahrscheinlich haben Sie die Geschichte vom
Besuch der Weisen aus dem Morgenland etwas anders in Erinnerung gehabt, als sie
in der Bibel steht. Von Königen ist in der Bibel nicht die Rede, sondern von
Weisen oder Sterndeutern, griechisch „magoi“. Ihre Namen werden in der Bibel
nicht genannt. Es wird auch nicht gesagt, wie viele es waren. Aus den drei
Geschenken Gold, Weihrauch und Myrrhe hat man darauf geschlossen, dass es drei
gewesen sind. Und sie kommen in der Bibel auch nicht zu einem Stall, in dem der
kleine Jesus in einer Futterkrippe liegt, sondern zum Haus von Maria und Joseph
in Betlehem. Nach dem Matthäusevangelium waren sie nämlich dort ansässig. Nach
der Geburt Jesu mussten sie nach Ägypten fliehen und siedelten sich dann in
Nazareth in Galiläa an. Im Lukasevangelium, dessen Weihnachtsgeschichte uns
vertrauter ist, waren Maria und Joseph dagegen schon vor der Geburt Jesu in
Nazareth ansässig und mussten wegen einer Volkszählung nach Bethlehem ziehen.
Diese Volkszählung fand nach unserem heutigen Wissensstand im Jahr 6 oder 7
nach Christus statt. Nach dem Matthäusevangelium wurde Jesus aber noch unter
der Herrschaft Herodes „des Grossen“ geboren, der im Jahr 4 vor Christus
gestorben ist.
Man sieht an diesen Widersprüchen zwischen
den Geschichten von der Geburt und Kindheit Jesu bei Matthäus und Lukas, dass
es sich hierbei um mehr oder weniger frei erfundene Legenden handelt. Markus
und Johannes und auch die übrigen Schriften des Neuen Testaments wissen von
alldem nichts zu berichten. Eine Reihe von späteren Evangelien, die nicht in
die Bibel aufgenommen wurden, erzählen dagegen noch viel mehr Geschichten über
die Zeichen und Wunder, mit denen die Kindheit und Jugend von Jesus verbunden
war.
Zum Beispiel das sogenannte
Kindheitsevangelium des Thomas. Da spielt der fünfjährige Jesus, nachdem es
geregnet hatte, am Übergang eines Baches. Er leitete das vorbeifliessende
Wasser in Teiche um und liess es klar werden – und das alles, ohne seine Hände
einzusetzen, allein durch das Wort. Aus weichem Lehm formte er zwölf Sperlinge.
Er klatschte in die Hände, da breiteten sie ihre Flügel aus und flogen
zwitschernd davon. Wenn ihn Kinder störten oder Erwachsene – besonders Lehrer –
ärgerten, konnte er sie schon einmal mit Blindheit schlagen oder tot umfallen
lassen – später aber auch wieder heilen und wieder auferwecken. Als einmal ein
Kind beim Spielen vom Dach fiel und starb, liess Jesus ihn wieder auferstehen,
und als sich ein junger Mann beim Holhacken den Fuss spaltete, heilte Jesus
ihn. Im Alter von acht Jahren half Jesus einmal seinem Vater Joseph bei der
Aussaat. Jesus säte nur ein einziges Weizenkorn aus – und erntete davon etwa
400 Liter Getreide.
Wie kamen die Christen dazu, sich solche
Geschichten über Jesus auszudenken? Wahrscheinlich dachten sie, dass ein später
so bedeutender Mensch wie Jesus schon in seiner Kindheit irgendwie aufgefallen
sein musste. Vielen Herrschern und Berühmtheiten der Antike hat man später
solche spektakulären Kindheitsgeschichten angedichtet. Man kann aber fragen, ob
solche Geschichten dem entsprechen, was Jesus später als erwachsener Mann
vertreten hat, was er gelehrt und gelebt hat. Sicher, Jesus wurde als
Wundertäter verehrt, aber doch als einer, der Menschen geheilt und ihnen
geholfen hat, nicht als einer, der Menschen durch seine Wundertaten eingeschüchtert
hat. Jesus hat nicht versucht, Menschen durch Macht und Gewalt zu überzeugen,
sondern durch Liebe und Freundlichkeit. Er hat sie gelehrt, auf Rache zu
verzichten und den Mächtigen und Brutalen mutig und ohne Gewalt entgegen zu
treten. Er hat sich foltern und kreuzigen lassen, um seine Freunde und
Nachfolger zu schützen.
Im Vergleich zu den Geschichten über Jesus im
Kindheitsevangelium des Thomas passen die Kindheitsgeschichten des
Matthäusevangeliums besser zu dem, was später aus Jesus wurde. Sie sagen, dass
sich in Jesus die messianischen Verheissungen der Heiligen Schriften erfüllt
haben, die Verheissungen eines endzeitlichen Königs, der Israel von der
Herrschaft fremder Völker befreien wird, der für Gerechtigkeit, Frieden und
Wohlstand sorgt, in dessen Reich die Völker ihre Schwerter zu Pflugscharen
umschmieden und selbst Wölfe und Lämmer in Frieden zusammen leben. Matthäus war
davon überzeugt, dass Jesus diese Verheissungen erfüllt hat – aber anders als
man sich das gemeinhin vorgestellt hatte: nicht als Herrscher mit politischer
Macht, sondern als Lehrer, als Heiler, als Tröster, als Visionär, als einer,
der Menschen an einem Tisch zusammengebracht und mit ihnen gefeiert hat, die
eigentlich nichts miteinander zu tun haben wollten.
An den Sterndeutern aus dem Morgenland zeigt
sich auf eine fast schon satirische Weise, wie Jesus die Erwartungen und
Hoffnungen der Menschen zugleich erfüllt und enttäuscht hat. Im antiken Orient
waren Sterndeuter hoch angesehene Gelehrte. Ihre Aufgabe war es, den Himmel zu
beobachten und auf besondere Himmelserscheinungen zu achten. Man meinte
nämlich, dass die Götter mit solchen Zeichen den Menschen Hinweise auf drohende
Gefahren gaben oder auch auf günstige Gelegenheiten. Es gab umfangreiche
Handbücher der Sterndeutung, aus denen man entnehmen konnte, was eine
ungewöhnliche Himmelserscheinung bedeuten könnte. Aufgrund ihrer Beobachtungen,
ihrer Kenntnisse und ihrer Fähigkeiten kamen die Sterndeuter zu dem Schluss,
dass in Judäa ein Kind geboren worden war, das einmal König werden sollte. Sie
begaben sich also mit wertvollen Geschenken, Gold, Weihrauch und Myrrhe, zum
Königshof von Judäa. Doch dort wusste man nichts von einem neugeborenen König.
Der Stern führte die Sterndeuter zu einem
ganz normalen Wohnhaus in Betlehem, wo ein ganz normales Ehepaar ein ganz
normales Kind zur Welt gebracht hatte. Sie erwiesen der Familie ihre
Ehrerbietung und lieferten ihre Geschenke ab. Was mag ihnen dabei durch den
Kopf gegangen sein? Dass der Stern sie an der Nase herum geführt hatte? Dass
dieses Kind einmal den judäischen Thron usurpieren würde? Je genauer man sich
diese Szene der Anbetung der Könige vorstellt, desto mehr macht sie einen etwas
komischen Eindruck, finde ich.
Doch das Lachen bleibt einem im Hals stecken,
denn diese Szene bringt Jesus und seine Familie und alle männlichen Babies und
Kleinkinder in Betlehem in akute Lebensgefahr, denn was die Sterndeuter ihm
erzählt haben, versetzt den judäischen König Herodes in helle Aufregung. Aus
Angst vor einem künftigen Konkurrenten richtet er unter den Knaben in Betlehem
ein Gemetzel an. Auch diese Geschichte ist wohl erfunden, nach dem Vorbild des
vom Pharao befohlenen Kindermords in Ägypten, aus dem Mose einst auf wunderbare
Weise gerettet wurde. Jesus wird so zu einer Art neuer Mose – und seine Familie
zu Flüchtlingen, die schliesslich in Galiläa eine neue Heimat finden.
Auch wenn die Geschichte vom Kindermord des
Herodes wohl eine Legende ist – sie wäre Herodes durchaus zuzutrauen. Er hat
während seiner Herrschaft über Judäa von 47 bis 4 vor Christus viel Gutes für
sein Volk getan, ist aber zugleich auch über Leichen gegangen, wenn er den
Verdacht hatte, dass Menschen seine Herrschaft bedrohen. 29
v. Chr. liess er seine Frau Mariamne hinrichten, im Jahr darauf auch seinen
Schwager Kostobaros wegen einer Verschwörung. 7 v. Chr. wurden zwei Söhne
Herodes von ihm des Hochverrats angeklagt und hingerichtet, zwei Jahre später
ein weiterer Sohn, den er zuvor zum Thronfolger bestimmt hatte. 6 v. Chr. ging
Herodes mit grosser Härte gegen Pharisäer vor, die das Ende seiner Herrschaft
prophezeit hatten.
In der Geschichte von den Sterndeutern aus
dem Morgenland verkörpert Herodes das brutale Gesicht menschlicher Macht, die
von Jesus demaskiert und unterlaufen wird. Die Macht des Herodes stösst an ihre
Grenzen bei einem wehrlosen Baby. Herodes‘ Herrschaft ist bald zu Ende. Er
stirbt nach einer langen, schmerzhaften und ekelerregenden Krankheit. Von
seinen Bauwerken sind heute nur noch Ruinen übrig. Jesus dagegen hat die Welt
verändert – zum Besseren, darf man wohl sagen, auch wenn seine selbsternannten
Nachfolger oft nicht den Versuchungen der Macht, des Reichtums und der
Ruhmsucht widerstehen konnten und die Sache Jesu leider viel zu oft mit
gewalttätigen Aktionen oder durch politischen Opportunimus verraten haben.
***
Eine moderne Variante der Geschichte von den Weisen
aus dem Morgenland stammt von Wolfgang Borchert und spielt in
Deutschland kurz nach dem Ende des zweiten Weltkriegs – eine Zeit in der die
Menschen in Deutschland in den Trümmern des Grössenwahns ihrer Regierung froren
und hungerten:
Die drei dunklen Könige
Er tappte durch die dunkle
Vorstadt. Die Häuser standen abgebrochen gegen den Himmel. Der Mond fehlte und
das Pflaster war erschrocken über den späten Schritt. Dann fand er eine alte
Planke. Da trat er mit dem Fuß gegen, bis eine Latte morsch aufseufzte und
losbrach. Das Holz roch mürbe und süß. Durch die dunkle Vorstadt tappte er
zurück. Sterne waren nicht da.
Als er die Tür aufmachte
(sie weinte dabei, die Tür), sahen ihm die blaßblauen Augen seiner Frau
entgegen. Sie kamen aus einem müden Gesicht. Ihr Atem hing weiß im Zimmer, so
kalt war es. Er beugte sein knochiges Knie und brach das Holz. Das Holz
seufzte. Dann roch es mürbe und süß ringsum. Er hielt sich ein Stück davon
unter die Nase. Riecht beinahe wie Kuchen, lachte er leise. Nicht, sagten die
Augen der Frau, nicht lachen. Er schläft.
Der Mann legte das süße
mürbe Holz in den kleinen Blechofen. Da glomm es auf und warf eine Handvoll
warmes Licht durch das Zimmer. Die fiel hell auf ein winziges rundes Gesicht
und blieb einen Augenblick. Das Gesicht war erst eine Stunde alt, aber es hatte
schon alles, was dazugehört: Ohren, Nase, Mund und Augen. Die Augen mußten groß
sein, das konnte man sehen, obgleich sie zu waren. Aber der Mund war offen und
es pustete leise daraus. Nase und Ohren waren rot. Er lebt, dachte die Mutter.
Und das kleine Gesicht schlief.
Da sind noch Haferflocken,
sagte der Mann. Ja, antwortete die Frau, das ist gut. Es ist kalt. Der Mann
nahm noch von dem süßen weichen Holz. Nun hat sie ihr Kind gekriegt und muß
frieren, dachte er. Aber er hatte keinen, dem er dafür die Fäuste ins Gesicht
schlagen konnte. Als er die Ofentür aufmachte, fiel wieder eine Handvoll Licht
über das schlafende Gesicht. Die Frau sagte leise: Kuck, wie ein
Heiligenschein, siehst du? Heiligenschein! dachte er und er hatte keinen, dem
er die Fäuste ins Gesicht schlagen konnte.
Dann waren welche an der
Tür. Wir sahen das Licht, sagten sie, vom Fenster. Wir wollen uns zehn Minuten
hinsetzen.
Aber wir haben ein Kind,
sagte der Mann zu ihnen. Da sagten sie nichts weiter, aber sie kamen doch ins
Zimmer, stießen Nebel aus den Nasen und hoben die Füße hoch. Wir sind ganz
leise, flüsterten sie und hoben die Füße hoch. Dann fiel das Licht auf sie.
Drei waren es. In drei alten
Uniformen. Einer hatte einen Pappkarton, einer einen Sack. Und der dritte hatte
keine Hände. Erfroren, sagte er, und hielt die Stümpfe hoch. Dann drehte er dem
Mann die Manteltasche hin. Tabak war darin und dünnes Papier. Sie drehten
Zigaretten. Aber die Frau sagte: Nicht, das Kind.
Da gingen die vier vor die
Tür und ihre Zigaretten waren vier Punkte in der Nacht. Der eine hatte dicke
umwickelte Füße. Er nahm ein Stück Holz aus seinem Sack. Ein Esel, sagte er,
ich habe sieben Monate daran geschnitzt. Für das Kind. Das sagte er und gab es
dem Mann. Was ist mit den Füßen? fragte der Mann. Wasser, sagte der
Eselschnitzer, vom Hunger. Und der andere, der dritte? fragte der Mann und
befühlte im Dunkeln den Esel. Der dritte zitterte in seiner Uniform: Oh,
nichts, wisperte er, das sind nur die Nerven. Man hat eben zuviel Angst gehabt.
Dann traten sie die Zigaretten aus und gingen wieder hinein.
Sie hoben die Füße hoch und
sahen auf das kleine schlafende Gesicht. Der Zitternde nahm aus seinem
Pappkarton zwei gelbe Bonbons und sagte dazu: Für die Frau sind die.
Die Frau machte die blassen
blauen Augen weit auf, als sie die drei Dunklen über das Kind gebeugt sah. Sie
fürchtete sich. Aber da stemmte das Kind seine Beine gegen ihre Brust und
schrie so kräftig, daß die drei Dunklen die Füße aufhoben und zur Tür schlichen.
Hier nickten sie nochmal, dann stiegen sie in die Nacht hinein.
Der Mann sah ihnen nach.
Sonderbare Heilige, sagte er zu seiner Frau. Dann machte er die Tür zu. Schöne
Heilige sind das, brummte er und sah nach den Haferflocken. Aber er hatte kein
Gesicht für seine Fäuste.
Aber das Kind hat geschrien,
flüsterte die Frau, ganz stark hat es geschrien. Da sind sie gegangen. Kuck
mal, wie lebendig es ist, sagte sie stolz. Das Gesicht machte den Mund auf und
schrie.
Weint er? fragte der Mann.
Nein, ich glaube, er lacht,
antwortete die Frau.
Beinahe wie Kuchen, sagte
der Mann und roch an dem Holz, wie Kuchen. Ganz süß.
Heute ist ja auch
Weihnachten, sagte die Frau.
Ja, Weihnachten, brummte er
und vom Ofen her fiel eine Handvoll Licht hell auf das kleine schlafende
Gesicht.
Abonnieren
Kommentare (Atom)